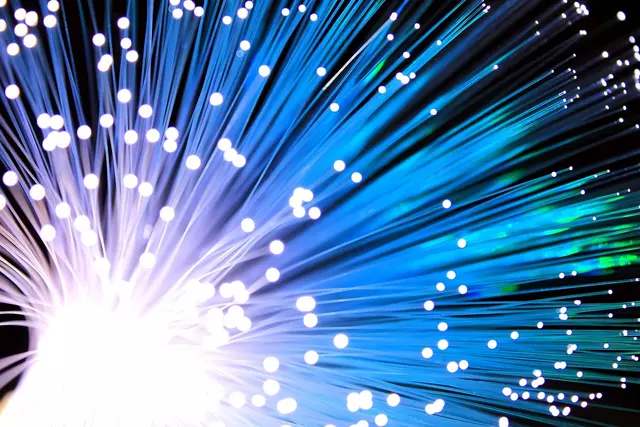Geschichte
Die Geschichte der Gemeinde Seebach
Das Bergdorf Seebach besteht als politisch eigenständiger Gemeindeverband erst seit dem Jahr 1818. Allerdings hatten sich seit dem zwölften Jahrhundert Siedler im hintersten Teil des Achertales niedergelassen, die dort Landwirtschaft betrieben. Sie arbeiteten als abhängige oder leibeigene Bauern unter anderem für die Ritter von Bosenstein und Schauenburg, die ihrerseits im Auftrag ihrer Lehnsherren handelten. Auch das Ende des 12. Jahrhunderts gegründete Kloster Allerheiligen verschaffte sich auf dem Gebiet der späteren Gemeinde Seebach Besitztümer, die bis zur Auflösung des Klosters im Jahre 1803 bestanden. Die Seebacher Bauernhöfe verteilten sich damals von Vorderseebach und Grimmerswald bis nach Hinterseebach und zum Höhengebiet, wo die geschlossene Waldkolonie Lenderswald angelegt wurde, die seit dem Jahre 1291 urkundlich belegt ist. Die erste urkundliche Erwähnung der Bauernhöfe im Seebachtal und im Grimmerswald datiert von 1347 und 1381.
Die Bauern im hintersten Teil des Achertals lebten Jahrhunderte lang von der Land- und Waldwirtschaft sowie vom Erzabbau im Seebacher Silbergründle. Von der "Großen Politik" blieben sie damals weitgehend unbehelligt. Sie bekamen lediglich die Auseinandersetzungen der Herren von Bosenstein mit den Straßburger Bischöfen zu spüren: Da die Bosensteiner die Hoheitsgewalt im hinteren Achertal für sich beanspruchten, gerieten sie mit den Bischöfen von Straßburg in Konflikt, die seit 1316 mit der Landesherrschaft über das Sasbach-, Acher- und Renchtal betraut waren. Dieser Konflikt wurde 1795 beigelegt, als der Straßburger Fürstbischof die Herrschaft Bosenstein für 30.000 Gulden erwarb. Im Jahr 1803 ging die Hoheitsgewalt der Bischöfe von Straßburg auf das badische Fürstenhaus über. Großherzog Carl Friedrich löste im Zuge der Neustrukturierung seines Herrschaftsgebietes in den Jahren 1817/1818 den Gerichts- und Verwaltungsbezirk Kappelrodeck auf und veranlasste die Gründung von drei neuen Gemeinden im hinteren Achertal. Seebach erhielt nach seiner Loslösung vom "Capplerthal" einen von der Bürgerschaft gewählten Bürgermeister und einen sechsköpfigen Gemeinderat. Die neue Selbstständigkeit der Gemeinde und die neue Freiheit der Bauern Seebachs, die von der Ablösung der Erblehen und des Zehnten regen Gebrauch machten, stürzte viele in Armut und soziale Not. 100 Seebacher machten sich auf den Weg nach Nordamerika, Wald musste verkauft werden. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Aufschwung bemerkbar: Sägewerke, Steinbruchbetriebe und der auf den Mummelsee ausgerichtete Fremdenverkehr wurden ein wichtiges "Zubrot" zur Landwirtschaft.
Nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung am Ende des Ersten Weltkrieges war den Betrieben und Familien der Gemeinde ein hartes Los beschieden, das in der Inflation des Jahres 1923 gipfelte. Um so erstaunlicher ist es, dass in den 20er Jahren das Zentrum, die Partei des politischen Katholizismus, in Seebach hoch in der Wählergunst stand, wurde sie doch für all das Elend verantwortlich gemacht. Trotz der finanziellen Notlage konnten die Seebacher 1924 den Bau einer eigenen Pfarrkirche abschließen, acht Jahre später erhielt der Ort den Status einer Pfarrkuratie. Konrad Fuchs war der erste Seelsorger.
Von einem starkem Gemeinschaftsgefühl im Dorf zeugen die zahlreichen Vereinsgründungen in der damaligen Zeit: So gründete sich 1907 der Musikverein, 1911 der Männergesangverein "Freundschaft", 1924 der Kirchenchor, 1927 der Ski-Club und 1936 schließlich die vorher lose organisierte Freiwillige Feuerwehr. Der Zweite Weltkrieg stürzte die Bevölkerung der Gemeinde Seebach in bisher nie gekanntes Leid und Elend. 130 Bürgersöhne des Dorfes mussten als Soldaten im Feld ihr Leben lassen. Mitte April 1945 näherten sich französische Kampfverbände der Gemeinde, die nach einigen Scharmützeln am 17. April 1945 von Franzosen besetzt wurde. Es folgte die fünfjährige französische Besatzungszeit: "Entnazifizierung" und Flüchtlingsprobleme mussten gemeistert werden, die kommunale Selbstverwaltung mit unbelasteten Bürgern nahm ihren Anfang. Nach der Währungsreform des Jahres 1948 machte sich erneute ein leichter Aufschwung bemerkbar.
In den fünfziger und sechziger Jahren entwickelte sich Seebach unter der Amtsführung von Bürgermeister Karl Sackmann zu einer modernen Wohngemeinde, in der der Wege- und Straßenbau forciert, das erste Wohnbaugelände erschlossen, die Ortskanalisation begonnen und die zentrale Wasserversorgungsanlage realisiert, der Fremdenverkehr gefördert und das kulturelle Leben mit engagierten Vereinen belebt wurde. In diese Zeit fiel auch die Verschwisterung von Seebach mit der elsässischen Gemeinde Ottrott. Im Jahre 1969 wurde Gerhard Bär erstmals zum Bürgermeister gewählt. Seine Amtszeit war geprägt von der Durchführung wichtiger Baumaßnahmen - auch für den Fremdenverkehr. In seine Ära fiel die Erlangung des Prädikates "Luftkurort". Ihm gelang es gemeinsam mit dem Gemeinderat auf der Grundlage einer Bürgeranhörung die durch die Kommunalreform bedrohte Selbstständigkeit der Gemeinde Seebach zu erhalten. Nach 24 Amtsjahren ging Gerhard Bär 1993 in den Ruhestand. Als Nachfolger wurde im September 1993 Reinhard Schmälzle in das Amt des Bürgermeisters gewählt. Er ist bestrebt, dass in der Kommunalpolitik Bürgermeister, Gemeinderäte und Verwaltung möglichst geschlossen an einem Strang ziehen und so in hohem Maße zum Wohle der Gemeinde und seiner Bewohner beitragen.
Auf dieser soliden Grundlage konnten in den letzten Jahren trotz der schwieriger gewordenen Finanzlage mit die größten Bauprojekte in der jüngeren Geschichte der Gemeinde in Angriff genommen werden. Hierzu zählen die Fertigstellung des Kindergartenneubaues, die Realisierung eines Mehrzwecksportplatzes, die Verwirklichung der lange ersehnten "Mummelseehalle", der Erwerb des Anwesens Decker mit Umsiedlung des Bauhofes, Realisierung von Vereinsräumlichkeiten und Anbau eines Feuerwehrgerätehauses. Gleichzeitig konnten mit über 10 km neuen Abwasserleitungen viele Hausbesitzer im Außenbereich in den Genuss der vollen Erschließung kommen, was den Eigentümern künftig eine spürbare Erleichterung bei der Genehmigung von Ausbauvorhaben bringt. Von besonderer Bedeutung für Seebach ist außerdem die Realisierung von neuem Wohn- und Gewerbebauland. Somit können junge Familien aber auch Gewerbebetriebe in der Gemeinde bleiben.
Besondere Anstrengungen wurden in der Entwicklung des Fremdenverkehrs unternommen. Mit der neuen Mummelseehalle, dem Bau eines Kioskes im Kurpark und der Erweiterung des Spielplatzangebotes konnte das Gästeangebot in Ortsmitte wesentlich verbessert werden. Eine ebenfalls große Bereicherung stellt das 1998 eingerichtete Naturschutzzentrum Ruhestein dar. Mit dem Ausbau des Wander- und Familienangebotes und der touristischen Wiedernutzung der Hornisgrinde will Seebach in Zukunft wieder zusätzliche Belebung in die Tourismusentwicklung bringen. Eine Besonderheit der Seebacher Geschichte bildet die Existenz der zwei eigenständigen Waldgenossenschaften Seebach und Grimmerswald. Vom Ursprung her ist der Waldbesitz beider Genossenschaften als "Allmendwald" zu bezeichnen. Bereits vor Gründung der eigenständigen Gemeinde Seebach erhielten die Waldrotten Seebach und Grimmerswald ihren anteiligen Wald von unterschiedlichen Vorbesitzern zugesprochen. Während die Genossenschaft Grimmerswald auf einen uralten Markverband "der Sasbacher Mark" mit einer damals schon festgefügten Rechtsordnung zurückgeht, wurde der Waldbesitz der Genossenschaft Seebach in einem Rechtsstreit mit dem Freiherrn Carl von Schauenburg im Jahre 1804 geregelt. Die Waldrotte und heutige Waldgenossenschaft Grimmerswald erhielt den Waldanteil nach langjährigen Aufteilungsverhandlungen endgültig im Jahre 1806 zugesprochen.
Obwohl der gemeinschaftliche Waldbesitz beider Waldrotten als Gemeindegliedervermögen anzusehen war, entschied man sich bei Gründung der politisch selbstständigen Gemeinde Seebach für eine getrennte Verwaltung, Nutzung und Vermögensrechnung. Immer wieder versuchten übergeordnete Behörden die Mitglieder der jeweiligen Waldgenossenschaften zur Angliederung des von der Hauptgemeinde getrennt geführten Waldbesitzes an die Gesamtgemeinde zu bewegen. Obwohl die Gemeinderäte und der Bürgermeister des politischen Gemeindeverbandes gleichsam auch die Verantwortlichen für die Verwaltung der Waldgenossenschaften waren, verweigerte man in großer Übereinstimmung das Ansinnen der übergeordneten Behörden. Erst in jüngster Zeit konnten aber klare Rechtsverhältnisse geschaffen werden. So gab einen langjährigen Rechtsstreit zwischen der Nachbargemeinde Ottenhöfen und der dortigen Waldgenossenschaft Ottenhöfen, welcher erst im Jahre 1978 letztinstanzlich vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim mit einem Vergleich beigelegt werden konnte. Die in diesem Vergleich u.a. getroffenen Regelungen des Satzungsrechtes sowie der künftig unantastbaren eigenständigen Vermögensverwaltung usw. waren auch auf die Seebacher Genossenschaften voll anwendbar. Somit wurden erstmals im Jahre 1980 unabhängig von den Gemeinderatswahlen die Verwaltungsräte der beiden Waldgenossenschaften von den jeweiligen wahlberechtigten Mitgliedern gewählt. Die jeweiligen Satzungen traten im Jahre 1981 in Kraft.
Verfasser:
Dr. Hans-Martin Pillin und Bürgermeister Reinhard Schmälzle
Ortschronik
Nachfolgend stellen wir Ihnen die einzelnen Kapitel der Seebacher Ortschronik von Hans-Martin Pillin "Das Mummelseedorf Seebach und seine Geschichte" als PDF Dateien zur Verfügung.
Kapitel 4 "Die Aufwärtsentwicklung Seebach nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-1990)"
Kapitel 5 "Die Seebacher Vereine in ihrer geschichtlichen Entwicklung"
Kapitel 6 "Das Wappen der Gemeinde Seebach"